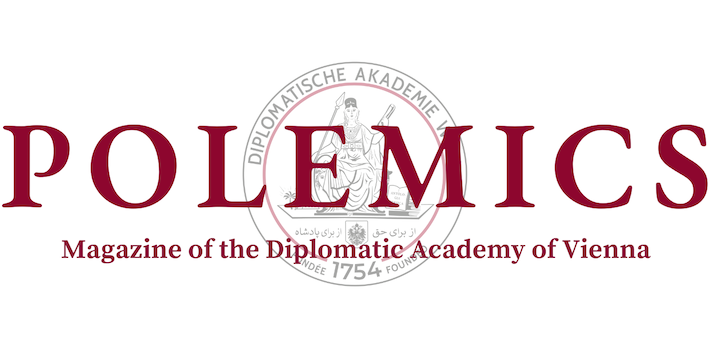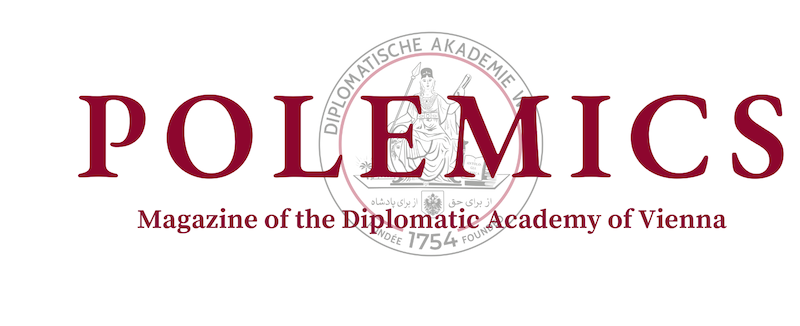Lange Zeit wurden die Bräuche der Tamazight-sprechenden indigenen Bevölkerungsgruppen des Maghrebs, die sich selbst als Imazighen (Einzahl Amazigh, übersetzt: die Freien) bezeichnen, im heutigen Volksmund auf pejorative Weise nach wie vor Berber genannt werden, im Maghreb unterdrückt; jedoch stellen diese neben der arabischstämmigen die größte Volksgruppe im heutigen Algerien dar mit einem Bevölkerungsanteil von 20 bis 30 Prozent
Das Verbreitungsgebiet der Imazighen erstreckt sich über die Länder Algerien, Marokko, Tunesien, Mauretanien, Libyen sowie über kleine Teile Ägyptens, Malis und Nigers. Obwohl historisch der Großteil Nordafrikas auf eine indigene Amazigh-Bevölkerung zurückblicken kann, haben dennoch sämtliche Länder eine „arabische“ respektive „muslimische“ Identität in ihrer innen.
Die Eroberung Nordafrikas durch Beduinenstämme der arabischen Halbinsel und die damit einhergehende Islamisierung der heute Maghreb genannten Region im 7. Jahrhundert stellte einen wesentlichen Wendepunkt für die Imazighen dar, und drängte deren Kultur weit in die unwirtlicheren Gebirgsregionen, wie zum Beispiel dem Atlasgebirge, zurück. Viele Bräuche und Elemente traditioneller Amazigh-Religionen sind bis heute noch sehr präsent und gehen auf Naturreligionen zurück, unter anderem die Verehrung von Wasserquellen oder die Opferung von Vieh zu Beginn der landwirtschaftlichen Anbauzeit. Dabei gestaltet sich die Kultur der Imazighen als äußerst vielschichtig; trotz dieser Diversität konnten sich viele der jahrhundertealten Traditionen bis heute erhalten.
In der Tat stellen die Imazighen keine einheitliche Volksgruppe dar, sondern setzen sich aus vielen kleineren ethnischen Gruppen zusammen, die sich durch Unterschiede in Sprache, Kleidung und Bräuchen erkennen lassen. Gleichsam splittert sich die gemeinsame Dachsprache, das Tamazight, in eine Vielzahl von Dialekten auf. Die in Frieden lebenden Kommunen schließen sich nur bei äußerlichen Bedrohungen zusammen und führen ein friedliches Zusammenleben.
Während des algerischen Unabhängigkeitskrieges kämpften Imazighen und Araber Seite an Seite, um sich vom gemeinsamen Feind, dem Kolonisator Frankreich, zu befreien. Trotz vieler Versprechen von Seiten der damaligen Befreiungsfront gingen die Imazighen nach 1962 leer aus und wurden nach 130-jähriger französischer Herrschaft nun Opfer einer streng implementierten Arabisierungswelle der neuen, unabhängigen Regierung – weder die Anerkennung der Sprache, noch ein föderales System standen zur Debatte. Lange nahm die identitätssuchende algerische Regierung die soziokulturelle Realität der Amazigh-Bevölkerung nicht wahr, bis es zu den ersten „Berberbewegungen“ kam. Der „Berberische Frühling“ (auf Tamazight: Tafsut Imaziɣen) im April 1980 bezeichnete eine Serie von Aufständen in der algerischen Region Kabylei, welche sowohl die amtliche Anerkennung des Tamazight als auch der Identität der Imazighen forderten. Dies stellte die erste Oppositionswelle seit Algeriens Unabhängigkeit am 1. November 1962 und der daraus folgenden staatlichen-organisierten Arabisierung dar.
Eine der Hauptfiguren im politischen Befreiungskampf der Imazighen war der algerische Schriftsteller Kateb Yacine, der schon vor den ersten offiziellen Aufständen in der Kabylei Kritik an der Arabisierungspolitik des „Front de Libération Nationale“ (die Nationale Befreiungsfront Algeriens und spätere Führungspartei des Landes) äußerte. In seinen Werken betont der Autor immer wieder, dass es in Algerien weder eine arabische Rasse noch eine arabische Nation, sondern lediglich die heilige Sprache des Korans gäbe, welche die Führer dazu benutzt hätten, Menschen ihrer Identität zu berauben, um diese somit besser zu kontrollieren. „Die Arabisierung zwingt einem Volk eine Sprache auf, die per se nicht die seinige ist, und lässt es daher gegen sich selbst kämpfen und im Zuge dessen sich selbst vernichten.“ Dies war nur einer seiner vielen Leitsprüche.
Obwohl die dreizehn Jahrhunderte im Gefolge der islamischen Eroberung und Okkupation die Basis für Algeriens kulturelles und politisches Zugehörigkeitsgefühl zu anderen arabischen Staaten bildeten, war derselbe Zeitraum gleichzeitig auch von der Unterdrückung des Tamazight geprägt.
Die seit 22. Februar 2019 friedlich stattfindenden Massenproteste, die eine grundlegende Veränderung des derzeitigen algerischen politischen Systems und vor allem eine neue Verfassung fordern, im Volksmund auch Hirak (auf Arabisch: Bewegung) genannt, stellen eine der weltweit beeindruckendsten soziopolitischen Bewegungen für demokratischen Wandel dar. Vor zwei Wochen „feierten“ diese friedlichen Proteste ihr einjähriges Bestehen und schafften somit einen Bruch der Angst in einer sich gegen Veränderung sträubende algerische Gesellschaft, die noch von den Folgen des brutalen Bürgerkrieges der 1990er Jahre traumatisiert ist. Der Auslöser der Proteste waren Bestrebungen des damaligen Präsidenten Abdelaziz Bouteflika zur Implementierung einer verfassungswidrigen fünften Amtszeit.
Der General Ahmed Gaid Salah, der als „starker Mann“ der algerischen Politik bis zu seinem Tod am 23. Dezember 2019 algerischer Verteidigungsminister war, äußerte sich sehr deutlich zur ohnehin ambivalenten staatlichen Stellung zur Amazigh-Bewegung, die im Zuge der friedlichen Proteste wieder auflebte und mit der Zeit immer stärker und herausfordernder für die Regierung wurde. „Algerien hat nur eine Flagge, für die viele Algerier als Märtyrer gefallen sind“ war die Reaktion des damaligen Armeeführers Algeriens, der getreu der Staatslinie die Karte der Zugehörigkeit zur algerischen Nation ausspielte. Dies stellt nur eines von vielen Beispielen dar, bei denen Amazigh-Identitätspolitik unterschlagen wurde.
Die Hirak-Proteste ermöglichten vielen Befürwortern „algerischer kultureller Diversität“ sich zu äußern und friedlich gegen die harsche Arabisierungspolitik des Landes zu demonstrieren. Nichtsdestotrotz macht Algeriens Justiz Ernst und statuiert durch seine politisch motivierten Urteile gegen „Berber“-Aktivisten ein Exempel. Obwohl das Tragen der Amazigh-Flagge gesetzlich nicht verboten ist, mussten sich die vergangenen Monate mehrere hundert Menschen für das „Schwenken der Berberfahne“ verantworten; Urteil: „das Untergraben und die Gefährdung der nationalen Identität Algeriens.“ Diese klassische divide-et-impera-Strategie wird demnach gezielt von der autoritären Staats- und Armeeführung des Landes angewendet um die arabische und amazighische Bevölkerung, die sich friedlich und solidarisch zu den wöchentlichen Freitagsdemonstrationen zusammenschließen, gegeneinander auszuspielen.
Die Protestbewegung lehnte die neu angesetzte Wahl im Dezember letzten Jahres ab, da diese keine wahrhaftige Veränderung der Verfassung bedeuten würde und zudem nur fünf Kandidaten, die der aktuellen politischen Führung nahestehen, zugelassen wurden. Es bleibt zu hoffen, dass die Proteste ein neues Kapitel für die Anerkennung der Amazigh und ihren Beitrag zur kulturellen Vielfalt des Landes beitragen und einem in friedlicher Revolte befindlichen Algerien helfen, die seit der Unabhängigkeit andauernde Identitätskrise zu überwinden und als Land von Abane Ramadane, Kateb Yacine und Mouloud Mammeri in neuem Glanz aufzublühen.